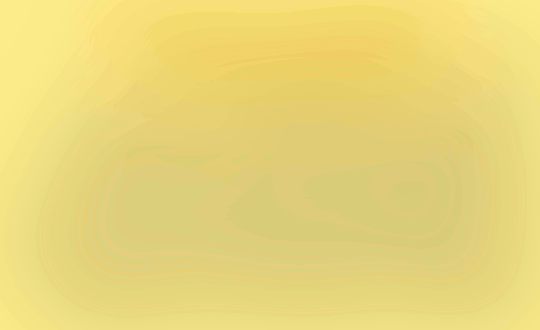Workshop
„Primary Health – Die Rolle der Community-based Vereine”
Ramazan Salman, Hannover
24. März 2011
Im
Workshop mit Ramazan Salman ging es darum, wie eine Initiative,
Organisation bzw. ein
Verein erfolgreich entwickelt werden kann. Als Beispiel diente
das MiMi-Konzept, das zuvor schon im Impulsreferat vorgestellt
wurde. MiMi, „Mit Migranten, Für Migranten”,
ist ein MultiplikatorInnen („MediatorInnen”)-Konzept
des Ethno-Medizinischen Zentrums (EMZ) Hannover für den
Gesundheitsbereich, das in mehreren deutschen Bundesländern und
auch außerhalb Deutschlands umgesetzt wird.
Zunächst
konnten Fragen gestellt und Kommentare zum Referat abgegeben werden –
woraus sich dann auch der weitere Workshop-Verlauf ergab.
Zuvorderst
wurde auf weitere Details von MiMi eingegangen:
Die
Anfänge von MiMi liegen 20 Jahre zurück (das
Ethno-Medizinische Zentrum war die erste
MigrantInnen-Selbstorganisation, MSO, in Deutschland) und betrafen
das Thema HIV/AIDS, das von den Regeleinrichtungen zu wenig bei den
MigrantInnen ankam. Es war von Anfang an ein aufsuchendes Programm
mit MediatorInnen, die im Rahmen des Konzeptes ausgebildet
wurden. Im Laufe der Zeit wurde die Umsetzung (Material, Curriculum,
Zusammenarbeit mit Hochschulen etc.) immer weiter verbessert.
Auch
trennte man allgemeine Gesundheitsprävention von „heikleren”
Themen, wie HIV/AIDS oder Sucht um jeweils eine passende,
vertrauensvolle Atmosphäre und entprechende Rahmenbedingungen zu
schaffen und die Themen kommunizierbar zu machen. Die gleiche
Technologie lasse sich auf verschiedene Themen anwenden.
Wichtig
sei eine Mischung im Team: MigrantInnen aus verschiedenen
Herkunftsländern, Deutsche, Frauen und Männer. Man müsse
„Friedens-orientiert”,
nicht monokulturell denken.
Die
Ausbildung zur MediatorIn habe man selbst angeboten, später auch
in Zusammenarbeit mit Universitäten (z.B. Rennes). Wichtig sei
auch eine Vielfalt an Kompetenzen der MediatorInnen.
Anfängliche
habe man sich ausschließlich auf staatliche Geldgeber
verlassen, aber über die Jahre die Finanzierung diversifiziert.
So sei zunächst die Krankenkasse hinzugekommen, was wertvolles
Know-How ins Projekt gebracht habe und für die Krankenkasse
einen Imagegewinn darstelle. Später kamen dann noch größere
Unternehmen dazu, die einen Social Responsibility-Etat haben. Auch
die staatlichen Geldgeber sind nicht nur auf Bundes- und Landesebene
sondern auch aus dem Kommunen.
Diese
dreifache Finanzierung sei sehr vorteilhaft, da man nicht etwa
durch Wahlen beeinflusst werde. Wichtig sei Transparenz und
überschaubare Ziele anzubieten, die auch sicher erreicht werden
können. Für Projekte in der Größe von MiMi müsse
man auch die Marke schützen (EU-weit, möglichst in jedem
Land einzeln).
Für
MSOs gelte es zunächst mit einer Mischung aus geförderten
und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen anzufangen und schrittweise
Augenhöhe mit Förderern und Netzwerkpartnern
einzufordern.
Das
MiMi-Projekt habe starke Netzwerkpartner, deren Betreuung aber
auch aufwändig sei. Differenzen, die zwangsläufig
auftreten müssen partnerschaftlich gelöst werden und nicht
konfrontativ. Regeldienste müssen für sich selbst Vorteile
sehen und es müsse sehr viel Vertrauensarbeit geleistet
werden, speziell von kleinen Vereinen.
In
großen Organisationen, wie z.B. Krankenhäusern, eine
Community-Strategie zu etablieren müsse man das Management
einbinden – nur das sei nachhaltig. Arbeite man mit
einzelnen MitarbeiterInnen, würden diese in der Organisation
fluktuieren und das Konzept nicht weiterführen.
Man
habe ein Handbuch für kleine Vereine ausgearbeitet,
das Buch „Sternstunden”.
Abschließend
wurde noch auf die Frage eingegangen, ob MiMi auch nach Österreich
kommen wolle. Dahingehend suche das EMZ eine Partnerorganisation
in Österreich, die die Technologie in mehreren Bundesländern
umsetzen könne. Alternativ könne man das Konzept einer
Organisation schenken, die müsse aber in der Lage sein, die
Maßnahmen erfolgreich umzusetzen und zu evaluieren. Als dritte
Variante sei ein Franchise-Konzept angedacht. Das Hauptziel des EMZ
sei die Verbreitung der Integrationtechnologie.
Man
denke auch an eine Anwendung des Konzeptes außerhalb Europas,
etwa in einem afrikanischen Land.
Im
Anschluss daran wurden an die TeilnehmerInnen Fragen gestellt und in
offener Diskussion erörtert. Die Antworten sich stichwortartig
wiedergegeben.
Was
hat sich bewährt?
Offen
sein – MSO haben guten Zugang zur Community – Infos
können besser übermittelt werden – die Zielgruppe
soll in die Umsetzung mit einbezogen werden – Empowerment der
Zielgruppe
Wovor
warne ich?
Nicht
zu sehr auf Kultur/Nationalität fokussieren – Zielgruppe
nicht undifferenziert darstellen – nicht Klischees fördern
(am schwierigsten für die Gruppe selbst) – kulturelle
Eigenheiten nicht bewerten.
Wozu
rate ich?
Auf
Know-How der MSO vertrauen, auch wenn teilweise am Standard vorbei
gearbeitet wird.
MSO
können auf „Konkurrenten”
zugehen und diese als Partner gewinnen.
Welchen
Bedarf hat meine MSO?
Kompetenz:
Es gebe Schulungen zu Anträgen, Abrechnung etc.
Finanzen
Professionalität:
Hier helfen Mitgliedschaften bei anderen Einrichtungen, Fortbildungen
Anerkennung
Rolle:
Akzeptanz der Netzwerker
Der
Bedarf muss auch artikuliert werden!
Infos
zu MiMi: http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/
FdP:
Stefan Kontur (ProHealth)
|