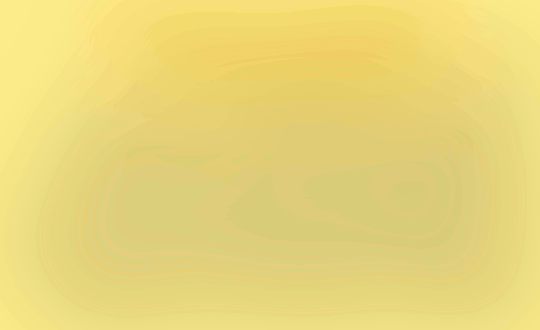Workshop
„Die Bedeutung von Gesundheit für MigrantInnen”
Rosaline M’bayo, Berlin
25. März 2011
Im
Workshop ging es – wie zuvor schon im Impulsreferat – um
die unterschiedlichen Auffassungen von Gesundheit und Krankheit,
und wie sich diese auf die Behandlung auswirken können.
Dazu
wurden die TeilnehmerInnen nach einer Vorstellrunde – in der
auch Erwartungen und ein evtl. vorhandener Migrationshintergrund
gesammelt wurden – in Gruppen eingeteilt. Bei der
Gruppeneinteilung wurde auf Migrationshintergründe
Rücksicht genommen. So arbeiteten z.B. die TeilnehmerInnen mit
einem Migrationshintergrund eines afrikanischen Landes
zusammen (im folgenden Gruppe I), oder alle ÖsterreicherInnen
(Gruppe II). Eine dritte Gruppe war demgegenüber sehr
heterogen – jede/r TeilnehmerIn aus einem anderen
Kontinent (Gruppe III).
Aufgabenstellung
war zunächst die (landläufige) Sicht
auf Gesundheit
zu definieren, was Gesundheit bedeutet und welche Rolle Religion,
Kultur und Tradition
dabei spielen.
Gruppe
I fand „persönliche”
Definitionen von Gesundheit: Gute Ernährung
und Bewegung,
seelisches und geistiges Wohlbefinden
(Glücklich sein, Zufriedenheit) und die Abwesenheit
von
Krankheit
bzw. Schmerzen. Krank sein sei demgegenüber ein Zustand mit
erheblichen körperlichen Auswirkungen („nicht mehr
aufstehen können”).
Traditionelle
Behandlungsmethoden
spielen eine große Rolle, diese werden aus Gründen
der Tradition
aber auch aus finanziellen
Gründen
gewählt, besonders bei bestimmten Erkrankungen. Die
Entscheidung,
ob
traditionelle
oder moderne Methoden zum
Einsatz kommen sei eine bewusste
und kulturelle.
Auch Religion
spiele eine große Rolle, so sei etwa der Pastor
bzw. eine Kirche
Anlaufstelle bei Erkrankungen. Der Glaube
an Gott
– bzw. rituell in Form von gesegnetem Wasser – sei für
manche genug Heilmittel und werde Medikamenten vorgezogen.
Gruppe
II sah Gesundheit als Balance
zwischen Körper, Seele und Geist
bzw. als „bio-psycho-soziales”
Wohlbefinden. Gesundheit und Krankheit werde in der Tradition
der Aufklärung
vornehmlich wissenschaftlich betrachtet. Gesellschaftlich sei
Gesundheit der „Normalzustand”,
der keine Behandlungsintervention notwendig mache (man habe ohnehin
„keine Zeit für´s Krank sein”).
Zur bissenschaftlich-medizinischen Betrachtung käme aber auch
(in letzter Zeit verstärkt) die traditionelle, überlieferte
und die spirituelle. Es gebe einen Trend zum „komplementären
Switchen”
im Sinne einer ganzheitlichen
Sichtweise.
Gruppe
III arbeitete Unterschiede
und Gemeinsamkeiten in drei verschiedenen Ländern
(USA, Südafrika, VR China) heraus. Gesundheit wurde ähnlich
definiert, als körperliches,
psychisches und seelisches Wohlbefinden.
Einflussfaktoren seien u.a. die Familie,
soziale
Gerechtigkeit,
kulturelles Verständnis in heterogenen Gesellschaften,
Arbeitsmöglichkeit
und gute Ernährung.
Aus spiritueller Sicht wurde die Rolle des Betens,
Segnens bzw. Meditierens festgehalten. Einer der Unterschiede sei die
Inanspruchnahme von Vorsorgemedizin,
die speziell in den USA schon aus finanziellen Gründen notwendig
sei (spätere Behandlungen seien sehr teuer).
Eine
zweite Aufgabe war dann, im Hinblick auf die Behandlung
von MigrantInnen in Österreich
Bedürfnisse zu definieren, Erwartungen zu formulieren bzw.
Lösungsvorschläge
zu machen.
Gruppe
III sah die Sprache
als Schlüssel. Information,
Aufklärung, Bewusstseinsbildung und das Schaffen von mehr
Vertrauen
in das Gesundheitssystem
durch Sensibilisierungsarbeit für die Gruppe der MigrantInnen
wurden als wichtige Lösungsansätze formuliert. Diese könne
durch MultiplikatorInnen,
wo MigrantInnen selbst als VermittlerInnen auftreten, geschehen, aber
auch durch spezifische
Angebote für MigrantInnen
(was auch eine Finanzierungsfrage
sei). MigrantInnen müssen aber auch selbst mehr nach außen
gehen und sich im österreichischen Kulturkreis bewegen.
Kultursensibilisierung
müsse von
beiden Seiten
betrieben werden.
Gruppe
II sah einen Lösungsansatz im Geben von Entscheidungshilfen
und Erleichtern von Zugängen
zu den entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten. Auch hier sei
die Ausbildung von Info-TrägerInnen
(MediatorInnen) und die Information über das ortsansässige
Verständnis im Dialog wichtig. Parallelitäten
seien zu akzeptieren und bieten eine Möglichkeit, voneinander zu
lernen.
Auch
Gruppe III wies neben ausreichenden Sprachkenntnissen
auf die Wichtigkeit von MediatorInnen
hin. Diese müssen allerdings eine passende Ausbildung
und die Motivation
für die Aufgabe mitbringen. Diese Arbeitsplätze müssen
geschaffen werden, was eine entsprechende Finanzierung
und damit das politische Einverständnis voraussetze. Darüber
hinaus sei die Partizipation
von MigrantInnen im Gesundheitssystem wichtig, was entsprechende
Projekte notwendig mache.
FdP:
Stefan Kontur (ProHealth)
|